Vom Sozialraum als Ding zu den subjektiven Raumdeutungen
Christian Reutlinger
Sozialgeografische Problematisierung der „sozialpädagogischen Rede von der Sozialraumorientierung“
In diesem Beitrag wird zunächst das gängige Verständnis von „Sozialraum“, insbesondere wie es seit Mitte der 1990er Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert wird, dargestellt und problematisiert (siehe dazu ausführlich auch Kessl/Reutlinger/Maurer/Frey 2005). In der Regel wird mit einer Kombination territorialer (vom Ort aus betrachtet) und struktureller (von der Organisationslogik aus betrachtet) Argumentationen versucht, den Sozialen Raum zu definieren bzw. zu gestalten. Auf der Strecke bleibt dabei eine subjektive oder soziale Perspektive, welche den Sozialen Raum vom Menschen aus betrachtet (zu den drei Zugängen siehe ausführlich Reutlinger/Wigger 2008). Aus diesem Grund wird im Abschluss eine Perspektive entwickelt, die an den Raumdeutungen der Menschen (Reutlinger 2008) ansetzt und ermöglichende Perspektiven im Sinne einer Sozialraumarbeit aufzeigt (Kessl/Reutlinger 2007; Reutlinger/Wigger 2008).
Einleitung
Folgt man der aktuellen „sozialpädagogischen Rede von der Sozialraumorientierung“ (vgl. Kessl/Reutlinger 2007), so scheint eines der Hauptprobleme darin zu liegen, wie man das diffuse Gebilde ‚Sozialraum‘ denn am besten mit Zahlen messbar und damit handhabbar machen kann. Es geht darum, wie man die Städte bzw. die territorialen Einheiten der Jugendhilfeintervention (bspw. als Sozialregionen) neu schneiden soll, damit die einzelnen Akteurinnen und Akteure kostengünstiger und effektiver arbeiten. Das heißt, in den Mittelpunkt gerät die Frage um die quantitative bzw. territoriale Ausdehnung des ‚Sozialraums‘: „So bewegen sich die Vorstellungen eines für die Sozialraumorientierung geeigneten Umfanges des Sozialraumes zwischen 30 000 und 80 000 Einwohnern“ (Münder 2001: 13). Wolfgang Hinte, als einer der sich am meisten exponierenden Vertreter der Debatte, schreibt zur Größe des Sozialraums, dass
„soziale Arbeit in Institutionen zu organisieren und methodisch zu praktizieren [ist] - und zwar immer mit Blick auf den Stadtteil (eine überschaubare sozialräumliche Einheit mit ca. 4.000 - 10. 000 BewohnerInnen) als den sichtbaren Ort der Folgen gesamtgesellschaftlicher Prozesse und Versäumnisse“ (Hinte 2001: 234).
Auch die Konzeptionen von Sozialraum wie von Jordan u.a. (2001), Wendt (1989) oder Elsen (1998) versuchen geografische Einheiten messbar zu machen.
Typischer Weise werden dafür anhand sozialökonomischer (und kriminalstatistischer) Daten Sozial-(und Kriminalitäts-)atlanten erstellt, um auf der Basis einer solchen „Sozialkartographie“ möglichst präzise Instrumente der sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Intervention erarbeiten zu können. (Kessl 2001: 41f.)
Hinter dieser Idee eines in Quadratmeter messbaren Raums steckt aus sozialgeografischer Perspektive die Gefahr der Verdinglichung des Sozialraums. Oftmals wird im aktuellen Sozialraumdiskurs die stadtsoziologische Logik des Schneidens von Territorien anhand von strukturellen ‚objektiven‘ Daten übernommen, ohne dass hinterfragt wird, was dies für Konsequenzen für die Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe hat. Hinter der stadtsoziologischen Vorgehensweise steht ein Prozess der Verräumlichung bzw. Verdinglichung des Sozialen (vgl. auch Reutlinger 2007): Es wird so getan, als ob die räumlichen Einheiten der Stadt, wo soziale Phänomene (insbesondere in Form einer Massierung von Problemlagen) auftreten, selbst die Eigenschaft dieser Phänomene besitzen würden. Durch die Verdinglichung der Sozialen Räume als Behälterräume (vgl. ausführlich Werlen 2005) drohen biografischen Bewältigungsaufgaben von Kindern, Jugendlichen und deren Familien, die ihren Wohnsitz in solchen ‚Sozialraumcontainer‘ haben, in der Unsichtbarkeit zu versinken (vgl. Reutlinger 2003). Deshalb muss vor jeglicher Verdinglichung des Sozialraums gewarnt werden.
Aus diesem Grund soll in diesem Artikel nicht das Schneiden eines einzigen Territoriums betrachtet, sondern es soll die ganze Stadt bzw. die strukturellen gesamtgesellschaftlichen Bedingungen in den Blick genommen werden (vgl. auch Reutlinger 2007).
Noch ein weiterer Tatbestand verdeutlicht die Notwendigkeit, den Sozialraum Stadt verstärkt zu thematisieren: die Tatsache, daß wir viel zu wenig wissen über die sozialstrukturelle Entwicklung und Veränderung von Lebenslagen verschiedener Bevölkerungsgruppen in den Städten und ihren Teilräumen. (Schmid-Urban 1997: 233)
Aus sozialgeografischer Perspektive soll deshalb im vorliegenden Artikel auf die Raumlogik des stadtsoziologischen Diskurses hingewiesen werden. Diese wird in der Regel im aktuellen Sozialraumdiskurs unreflektiert übernommen und steckt hinter der Idee der Dingfestmachung von sozialen Räumen als quantitativ messbare Einheiten in der Stadt. Die Vermischung von stadtsoziologischem Diskurs und dem Umbau der Jugendhilfe hat gerade in der Sozialraumdebatte gravierende Konsequenzen für die Bewohnerinnen und Bewohner bestimmter Stadtteile, indem sie in physisch-materiellen Raumsegmenten eingeschlossen und dadurch weiter sozial- und auch räumlich ausgegrenzt zu werden drohen. Dabei ist gerade die unreflektierte Übernahme der sozialräumlichen Logik der Stadtsoziologie als Raumlogik (das gesellschaftliche Abgehängtsein wird territorial festgeschrieben – siehe unten) besonders brisant. Oft wird übersehen, dass der in der Stadtsoziologie parallel geführte Diskurs nicht als Sozialraum-, sondern als „Quartierdiskurs“ (vgl. Alisch 1997; Schnur 2008) geführt wird – die Gleichsetzung von Quartier und Sozialraum ist nicht ohne Weiteres zulässig, was aufzuzeigen ist. Anhand der ‚gespaltenen Stadt‘ als Symbol für die aktuelle urbane Realität in Westeuropa, soll die dahinter liegende territoriale Idee nachgezeichnet werden. Aufbauend auf den Kenntnissen der Segregationsforschung, fokussieren so auch aktuelle städtebauliche Programme wie ‚Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt‘ [1] (kurz ‚die Soziale Stadt‘) im Unterschied zu früheren Programmen nicht bestimmte Zielgruppen bzw. AdressatInnen, sondern bestimmte Territorien in der Stadt (vgl. bspw. Walther 2002). Jugendhilfepolitische Programme wie die ‚Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten‘ [2] (E&C) beziehen sich auf diese Territorien und bezeichnen sie als ‚Sozialräume‘. Somit laden sich diese Programme auch die ähnlichen Probleme auf: Der ‚Verdinglichungsprozess‘ kann anhand der Idee, diese Territorien als ‚soziale Räume‘ zu bezeichnen, nachgezeichnet werden. Abschließend sollen die Gefahren aufgezeigt und Perspektiven aus dem verdinglichten Sozialraum hinaus aufgemacht werden.
1. Die Folgen des Strukturwandels der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft - die gespaltene Stadt
Bislang galt die Stadt als ‚Integrationsmaschine‘ (Heitmeyer 1998), in welcher Menschen mit verschiedener sozialer und kultureller Herkunft eine Möglichkeit fanden dazuzugehören.
Herausragendes Merkmal der europäischen Stadt des 20. Jahrhunderts war und ist, daß sich zwischen soziale Ungleichheit und Wohnbedingungen ein Puffer schob, der die Verdoppelung von Benachteiligung durch sozialräumliche Ausgrenzung verhinderte. (Häußermann 1998: 162)
Im Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft, im Rahmen des „digitalen Kapitalismus“ [3] (Böhnisch/Schröer 2001) - in Abgrenzung zum industriellen Kapitalismus - geht es immer mehr um Zugänge zur Arbeit (vgl. Rifkin 2000). Damit droht die Stadt die integrative Kapazität zu verlieren, da der Mithaltedruck für immer mehr BewohnerInnen ständig ansteigt und immer mehr Menschen überflüssig werden. Die Konfliktpotenziale, welche sich aus der Entwicklung ergeben, bewirken eine Spaltungstendenz der Städte [4]: Der wirtschaftliche Strukturwandel führt zu einer Polarisierung von Regionen und Städten in solche,
in denen weiterhin die Wachstumsperspektive dominiert, und in solche, wo Tendenzen ökonomischer Stagnation und sozialer Marginalisierung deutlicher hervortreten; zum anderen führt der Strukturwandel zu einer Polarisierung innerhalb der Städte, indem sich soziale Unterschiede verschärfen und sozialräumlich deutlich sichtbar werden (Häußermann 1991: 93).
Im Zuge der globalen wirtschaftlichen Verflechtung orientieren sich sowohl Wirtschaft als auch Politik an den konsumkräftigen Bewohnern einer Stadt. Es kommt zunehmend zu einer räumlichen und sozialen Polarisierung der Bevölkerung der Städte und letztlich der Stadt selbst. Das (im Falle von Deutschland seit den 1970er-Jahren) erneute Auseinanderdriften von Chancen im Arbeits- und Wohnungsmarkt, der Erreichbarkeit öffentlicher Einrichtungen und des Angebots an (Aus )Bildungschancen führt zu einer Spaltung der Bewohner einer Stadt (vgl. Dangschat 1999: 27f.). Aus dieser Tendenz heraus wird für die Zukunft ein Versagen der bisher funktionierenden ‚Integrationsmaschine‘ Stadt vorausgesagt.
Anhand des aktuellen stadtsoziologischen Diskurses um Städtespaltung gilt es in der Folge die unterschiedlichen urbanen Realitäten (Stadt der Gewinner vs. Stadt der Verlierer) und die damit verbundenen räumlichen Vorstellungen darzustellen.
Stadt der Gewinner
In einer globalen Wirtschaft geht es um die internationale Konkurrenz der Produktionsstandorte. Damit muss sich eine Stadt auf dem internationalen Markt behaupten und sich auf den internationalen Wettbewerb einlassen. Nach Sassen (1996) erhalten die Städte innerhalb des Geflechts der globalisierten Ökonomie die Rolle von Katalysatoren, indem sich transnationale Firmen in den Städten niederlassen können, um die internationalen Personal-, Kapital- und Warenströme zu organisieren. Die Stadt ist dafür verantwortlich, eine Umwelt bereitzustellen, die für Unternehmensgründungen und -ausdehnungen förderlich ist. Es geht dabei um die Frage, was die Städte für die Unternehmen leisten. Die Stadt
...muss Dienstleistungsunternehmen für alle Bürger der Stadt sein. Sie kann nur dann ein guter Wirtschaftsstandort sein, wenn sie die Anforderungen der Arbeiter wie der Unternehmer, der älteren wie der jüngeren Menschen, wenn sie die Ansprüche der unterschiedlichen sozialen Gruppierungen zu erfüllen trachtet (Eichel 1991: 98).
Die so genannte ‚unternehmerische Stadt‘ ist nicht mehr eingebunden in eine größere (territoriale oder soziale) Einheit, sondern ist unter globalen Bedingungen der Wirtschaft vielmehr zu sehen als eine Konkurrentin anderer Kommunen, Städte und Regionen in einem globalen Wettbewerb. Die Stadt muss sich auf dem internationalen Markt behaupten und sich als erfolgreiches Produkt anpreisen und verkaufen. Um dies möglichst erfolgreich und gewinnbringend zu tun, wird eine Politik zur Steigerung der Standortqualität verfolgt. In der heutigen Stadtpolitik geht es darum, ‚den Herausforderungen durch die Globalisierung‘ zu begegnen, indem durch Deregulierungen und Flexibilisierungen, Wirtschaftsförderungsprozesse und Anreizpläne ein wirtschaftsfreundliches Klima geschaffen wird (nach Dangschat 1999: 29).
Bei der Umsetzung der Standortpolitik lassen sich nach Berger/Schmalfeld (Berger/Schmalfeld 1999: 320) die folgenden drei neuen Formen lokaler Wirtschaftspolitik unterscheiden:
- Public-private-partnership. Während in den 1960er- und 1970er-Jahren traditionelle Formen der Kooperation zwischen dem öffentlichen Sektor der Stadt und den privaten Unternehmen bestanden und es darum ging, durch Anreize wie zum Beispiel Steuererleichterungen, billigeres Land und andere Subventionen die Firmen an die Standorte zu binden, bestimmen heute vermehrt wachstumsversprechende Formen und bestimmte Kooperationsleistungen dieses Verhältnis. Die Stadt schließt sich mit den Unternehmen zusammen und es kommt zur Privatisierung traditionell öffentlicher Bereiche. Dies beginnt bspw. damit, dass die Stadtreinigung von einer privaten Firma übernommen wird und geht soweit, den privaten Sektor damit zu beauftragen, soziale Probleme möglichst effizient und kostengünstig zu lösen. [5]
- Förderung ‚weicher‘ Standortfaktoren. In einer erfolgreichen Stadtpolitik zur Herstellung eines positiven Geschäftsklimas müssen nach Häußermann/Siebel zunehmend die ‚weichen‘ Standortfaktoren [6] gefördert werden. Bei weichen‘ Standortfaktoren geht es um die Steigerung der Attraktivität eines Standortes. Hierzu zählen beispielsweise Bemühungen um die Ansiedlung privater Kultur- und Freizeiteinrichtungen, welche als ‚Inszenierung‘ von ‚Kultur‘, resp. ‚Kulturalisierung‘ der Politik beschrieben wird. Investitionen in Kunst, Subventionen für Theater und Musicalanbieter, die Unterstützung von kulturellen Großereignissen wie internationalen Kongresse, Ausstellungen, Festivals usw. steigern die Attraktivität einer Stadt (vgl. Häußermann/Siebel 1993).
Im Zusammenhang mit der Förderung der ‚weichen‘ Standortfaktoren ist die Ästhetisierung des Stadtbildes entscheidend. In diesem Zuge werden Innenstädte saniert, alte leer stehende Fabrikanlagen auf originelle Weise umgebaut und multifunktional genutzt, es entstehen neue moderne Bauten, die die Attraktivität der Städte für Touristen und Geschäftsleute steigern sollen.
Sowohl die Inszenierung von ‚Kultur‘ als auch die Ästhetisierung des Stadtbildes sind beim Aufbau eines Images entscheidend. Bei der Vermarktung des Produktes ‚Stadt‘ geht es um eine erfolgreiche Werbung und um den Verkauf des Images. Oft beruft man sich beim Aufbau dieses Images auf Traditionen, was sich in den Worten von Giddens (1996) als „Ambivalenz reflexiver Modernisierung“ zusammenfassen lässt. - Strategien der Verdrängung. Bei der Schaffung von hochwertigen Zonen für Geschäfte im IT- und Dienstleistungsbereich kommt es zur massiven Ausdehnung dieser Gebiete innerhalb der Stadt. Die erneute Ausdehnung der städtischen Zentren führt in vielen Fällen zu Konflikten, da sie lange Zeit vernachlässigte Quartiere und Bevölkerungsschichten betrifft. Bei dieser Art der Stadtpolitik geht es verstärkt um die Macht des einen Teils der Bevölkerung, der seine Interessen wahrnehmen und sich breit machen kann, während der andere weichen muss. Architektur und Raumplanung sind auf diese Verdrängung ausgerichtet und es kommt im Rahmen des postmodernen Städtebaus zur ‚Expandierung und Eroberung‘ von neuen Gebieten der Stadt für Unternehmen und deren Angestellte. Die neuen Formen der Architektur setzen „wachsende gesellschaftliche Macht in die Beherrschung neuen städtischen Territoriums um“ (Rodenstein 1992: 65).
Standortpolitik der Ausgrenzung und Unsichtbarmachung sozialer Probleme
Zu einem großen Teil der Stadtentwicklungspolitik geht es, wie im letzten Abschnitt dargestellt wurde, um die Förderung des Standortes im globalen Wettbewerb - wie weiter unten aufgezeigt wird, gibt es wie im Beispiel der ‚Sozialen Stadt‘ auch Stadtentwicklungspolitiken, die bemüht sind, sich auch um die Verlierer der beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen zu kümmern. Der hauptsächliche Teil der Energien und Ressourcen wird jedoch auf die Verfolgung der Ziele, die zur Förderung des Standortes dienen, ausgerichtet. Bei der Umsetzung einer Stadtpolitik im aufgezeigten Sinne kommt es zu einer Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich.
Die Verdrängungsprozesse von einkommensschwachen Gruppen aus den Altbaugebieten der großen Städte (‚Gentrification‘ [7]), die mit Steuererleichterungen und häufig auch durch städtische Planungsmaßnahmen unterstützt werden, sind Anzeichen dafür, daß sich mit dem ökonomischen Strukturwandel in den Städten auch die politischen Prioritäten verschieben. (Häußermann 1991: 97)
Die Ursachen der neuen Spaltungstendenz werden oft übergangen. Es kommt zur Ausgrenzung sozialer Probleme, da sie die BewohnerInnen der ‚unternehmerischen Stadt‘ nicht interessieren. Die konsequente soziale und räumliche Ausgrenzung von sozialen Problemen bzw. von den Menschen mit sozialen Problemlagen ist notwendig und hilfreich für die Umsetzung der Standortpolitik, da sie das Leben innerhalb der Zentren stören. Wer mag beim ‚Shoppen‘ schon über einen Landstreicher steigen, der sich auf einem Karton vor einer Designerboutique zum Betteln hingelegt hat? So ist auch zu verstehen, dass sich der Wohlstand auf Kosten der Armut ausbreitet, dass heute nicht mehr von ‚Armut im Wohlstand‘, sondern von ‚Armut durch Wohlstand‘ (vgl. Dangschat 1999) die Rede ist. [8] Nach Dangschat (1999) ist die soziale und räumliche Ausgrenzung hilfreich für die Sicherung, dass es keinen ernsthaften Widerstand gegen die Interessen des Kapitals gibt. Die soziale Ausgrenzung gelingt durch die immer größeren Einschränkungen der Leistungen und Absicherung des Sozialstaates. Die räumliche Ausgrenzung ist wiederum
Voraussetzung dafür, Wohlstand und Reichtum in Seelenfrieden genießen zu können (segregierte und bewachte Wohnviertel, Sicherung des ‚Erlebniseinkaufs‘ und Kommerzialisierung insbesondere des mit moderner Architektur gestylten öffentlichen Raumes) (Dangschat 1999: 14).
Durch die ungleiche Verteilung von Macht und Einfluss droht die Stadtentwicklungspolitik sich hauptsächlich auf die so genannte ‚erste Stadt‘ zu konzentrieren. Häußermann und Siebel (1995) sprechen im Rahmen der sozialen und räumlichen Ausgrenzung von einer Dreiteilung der Stadt. Die ‚erste Stadt‘ ist dabei
organisiert hin auf die Konkurrenz mit anderen Metropolen und deshalb ausgerichtet auf die Anforderungen und Bedürfnisse einer international orientierten Schicht von Geschäftsleuten, Kongreß- und Messebesuchern. Auf diesen Teil der Stadt konzentriert sich die Entwicklungspolitik der Stadtregierung zunehmend.
In diesem Zusammenhang wird die so genannte zweite Stadt als „Versorgungs- und Wohnstadt“ der Mittelschicht gesehen. Schließlich ist die dritte Stadt „die marginalisierte Stadt der Randgruppen, der Ausgegrenzten, der dauerhaft Arbeitslosen, der Ausländer, der Drogenabhängigen und der Armen“ (Häußermann/Siebel 1995: 138f.).
Die Entwicklung der ersten Stadt geht auf Kosten der dritten, marginalisierten Stadt und in der Stadtpolitik geht es lediglich darum, dass diese Gebiete nicht so groß werden, dass sie eine Bedrohung für die erste Stadt werden könnten. Konflikte, die den ‚sozialen Frieden‘ stören könnten, sollen vermieden werden. [9] In der ‚aus den Augen, aus dem Sinn‘-Taktik geht es aber nicht um ein wirkliches Lösen der Probleme, sondern lediglich um kosmetische Maßnahmen. Der Irrtum besteht „im Glauben, Benachteiligung sei geringer, wenn sie nicht so gut sichtbar ist“ (Häußermann/Oswald 1996: 96). Es wäre zu prüfen, ob es durch die neuere Tendenz von Stadtentwicklungspolitiken wie die ‚Soziale Stadt‘ wirklich gelingt, den Bewohnerinnen und Bewohner der ‚dritten Stadt‘ mehr Zugänge zu verschaffen, oder ob „das Politikfeld ‚soziale Stadt‘“ nicht zu einem „Forum der blumigen Rhetorik, des ineffizienten Aktivismus und der symbolischen Politik“, wovor beispielsweise Schnur warnt (Schnur 2003: 347), zu werden droht.
Aufbau einer unsichtbaren Mauer - Räumliche Konsequenzen der Spaltung der Städte
Die soziale und räumliche Ausgrenzung der Randgruppen führt mehr und mehr zur Entstehung und Verstärkung einer unsichtbaren Mauer, entlang welcher es zu einer Spaltung der Stadt kommt.
Durch Architektur und Infrastruktur wird eine unsichtbare Mauer gebaut, die sozial benachteiligte Menschen aus der ‚ersten‘ Stadt verdrängt - ästhetische Codes und dominante Verhaltensweisen symbolisieren in diesem Räumen, wer ‚dazu‘ und wer ‚nicht dazu‘ gehört. (Berger/Schmalfeld 1999: 326)
Es kommt zur sozialen Ausgrenzung einer immer breiter werdenden Bevölkerungsschicht durch städtebauliche Maßnahmen, die auf die komplette Verdrängung dieser Menschen abzielen. Die Architektur der in den Innenstädten neu entstehenden Gebäude und räumlichen Ausschnitte (beispielsweise Einkaufspassagen der City, Bahnhöfe, öffentliche Plätze) ist gekennzeichnet durch eine ‚Innenwendung‘. Diese Bauten sprechen mit ihren glatten und gestylten Fassaden eine abweisende Sprache nach außen hin, drinnen laden sie jedoch zum Einkaufen, Konsumieren oder zum Flanieren ein. Durch eine abweisende und pompöse Architektur soll die Zugangsschwelle erhöht, der Zugang für ‚Unerwünschte‘ oder ‚Ausgegrenzte‘ beschränkt werden. In diesem Zusammenhang wird von der Tendenz zur Privatisierung öffentlichen Raumes gesprochen. In diesen räumlichen Ausschnitten gilt das Hausrecht des jeweiligen Verwalters oder (Geschäfts )Besitzers. Störende Personen werden durch die Polizei oder immer mehr durch private Sicherheitsfirmen ‚entfernt‘ oder gar nicht erst eingelassen.
Obdachlose, bettelnde oder sonst wie ‚abweichende‘ Menschen können - wenn sie durch die Ästhetisierung nicht ohnehin abgeschreckt werden - aus diesen Räumen verbannt und ausgegrenzt werden, um den Aufenthalt und das ‚Erlebnis‘ derjenigen nicht zu stören, die durch ihre Umsätze für die notwendige Rentabilität dieser Räume sorgen. (Berger/Schmalfeld 1999: 325)
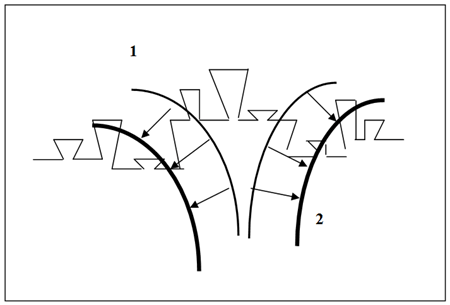
Abbildung 1: Aufbau einer unsichtbaren Mauer in der gespaltenen Stadt
In der ersten Stadt haben sozial benachteiligte Menschen nichts zu suchen, sie ist zugänglich für die ‚Erfolgreichen‘, die so genannten ‚global player‘ oder ‚Lebensstiltypen‘, welche die sozialen resp. ökonomischen Möglichkeiten besitzen, sich den räumlichen Zugang zu diesen Orten zu erkaufen. Aus der Sicht der ersten Stadt bzw. der damit zusammenhängenden Stadtpolitik geht es vorrangig darum, die ‚Abgehängten‘, ‚Unerwünschten‘ oder ‚Verlierer‘ dieser Entwicklung von diesen Orten fernzuhalten.
Die unternehmerischen Strategien der Stadt orientieren sich an der Erfolgsgruppe der aufstrebenden Dienstleistungsklasse: „Hochgebildet, kinderlos, mit hohem Einkommen versehen, innenstadtnah wohnend, mit protestantischem Arbeitsethos und zugleich mit einem ausgeprägten Hedonismus versehen“ (Dangschat 1998: 70). Diese Gruppe der Gewinner wird in die Standortpolitik eingespannt.
Gegenwärtig findet in Städten und Stadtregionen eine zunehmende distinktiv eingesetzte Form der Besitznahme von Raum durch die Sieger ökonomischer Umstrukturierung bei gleichzeitiger Einengung der Verlierer in wenig attraktiven und benachteiligten Räumen statt. Diese Räume sind ihrerseits durch räumliche Konzentrationen weiter struktureller Nachteile gekennzeichnet (Wohnungsnot, Obdachlosigkeit, Unterversorgung in der Nahrungsversorgung, der Bildung und der Gesundheit). Damit ist die Basis für eine weitergehende stadtgesellschaftliche Desintegration und stadtstrukturelle Erosion gelegt. (Dangschat 1998: 70f.)
Eine unsichtbare Mauer wird aufgebaut, die die Orte der ‚insider‘ von denjenigen der ‚outsider‘ abriegelt und trennt. Die ‚Verdrängten‘ befinden sich sozial und räumlich in der dritten Stadt, welche die erste Stadt und ihre Bewohner, solange die ‚unternehmerische Stadt‘ nicht bedroht ist, nicht interessiert bzw. für sie unsichtbar ist. In dieser ‚überflüssigen‘ oder ‚störenden Stadt‘ konzentriert sich die sozial benachteiligte Bevölkerung, die gerade durch ihre räumliche und soziale Ausgrenzung ständig an Möglichkeiten verliert, jemals in die erste Stadt hineinzukommen und somit in die Gesellschaft integriert zu werden. Die Ausgrenzung aus dem größten Teil städtischer Raumsegmente, aber auch die symbolische Ausgrenzung aus öffentlichen Räumen führt dazu, dass immer mehr Menschen am kulturellen und sozialen Leben nicht teilhaben können.
Räumliche Ausgrenzung ist so zweifach wirksam. Zum einen schränkt sie den Zugang zu Orten ein, zum anderen führt sie gleichzeitig zu einer geringeren Beteiligung am sozialen städtischen Leben. (Friedrich 1999: 277)
Die Polarisierungstendenzen innerhalb der Sozialstruktur führen zum vermehrten Auseinanderdriften der ersten oder ‚unternehmerischen Stadt‘ und der dritten ‚abgehängten Stadt‘. Diese Spaltung erhöht sich weiter durch die laufende Einschränkung der Möglichkeiten von sozialen Gruppen aus der ‚überflüssigen Stadt‘, sich den Raum anzueignen. Es kommt zu einer Verstärkung der sozialen Segregation [10], da Nutzen und Aneignungsmöglichkeiten von Orten, (Definitions )Macht über räumliche Ausschnitte der Stadt sowie die Verfügung von sozialen, ökonomischen und kulturellen Ressourcen auseinander driften und immer ungleichmäßiger verteilt sind. Aus diesem Grund werden die sozialen und räumlichen Unterschiede der Städte immer größer. Die Spaltung der Städte schreitet so stetig voran.
In den letzten Jahren erleben wir deshalb eine Verstärkung der sozial-räumlichen Unterschiede zwischen Stadtgebieten, die besonders der sozialen Segregation einen neuen Stellenwert gibt: Es kommt zu einer anwachsenden Polarisierung zwischen Stadtgebieten. Gebiete, die von einer Bevölkerung mit hohem Einkommen geprägt sind, werden zudem wohlhabender, und Stadtgebiete mit Bewohnern mit geringerem Einkommen weiten sich in der Fläche aus und werden ärmer. (Friedrich 1999: 265)
Stadt der Verlierer
Durch ungleiche Verteilung von Ressourcen sind auch die Chancen der Menschen in der Stadt ungleich verteilt. Diejenigen Bevölkerungsgruppen, die nicht zum Kern von Unternehmern, Managern und hochqualifizierten Fachkräften zählen, lassen sich als Bewohner der ‚Stadt der Verlierer‘ bezeichnen.
Diese Schicht, die sich in erster Linie durch ihre Nichtteilhabe am ökonomischen Kern der städtischen Wirtschaft (also durch eine fehlende Beteiligung an der Macht und einen erschwerten Zugang zu den Informationsströmen der Weltwirtschaft) charakterisieren lässt, ist stark fragmentiert und umfasst die unterschiedlichsten Wertvorstellungen, Lebensstile und Kulturen. (Schnur 2003: 3)
Neben einer zusätzlichen Benachteiligung durch die Wohnbedingungen (wie z.B. eine hohe Belegungsdichte, schlechte Ausstattung, hohe Kosten, ein einschränkender Grundriss der Wohnung sowie Wohnungsmängel wie Feuchtigkeit, Dunkelheit, Belästigung durch Lärm etc.) und Wohnumfeldbedingungen (benachteiligende Sozial- und unzureichende Infrastruktur, mangelnde Erreichbarkeit, starke Immissionen, schlechtes Image, eingeschränkter Zugang zu öffentlichem und halböffentlichem Raum; vgl. Dangschat 1999: 17) sind sozial benachteiligte Stadtgebiete oft von einer schleichenden Abwertung betroffen, die die Situation der Bewohner weiter verschlechtert. Das führt zu einem vermehrten Auftreten von sozialen Problemen. Hinzu kommen kulturelle Ausgrenzungsformen, die die räumliche Ausgrenzung zusätzlich verstärken.
Je stärker sich Stadtteile nach dem sozialen Status differenzieren, die räumlichen Partizipationsmöglichkeiten ungleich verteilt sind und benachteiligte Menschen sich in bestimmten Stadtgebieten konzentrieren und sich ihre Lebenswelt stärker in diesen Gebieten abspielt, weil sie weder über finanzielle, soziale oder kulturelle Ressourcen verfügen, andere Orte zu nutzen, desto mehr greifen die Folgen dieser Ausgrenzung. Die räumliche Ausgrenzung in ihrer Gesamtheit wird selber zu einem Faktor, der soziale Ungleichheit und Benachteiligung erzeugt und die Lebenslage von Betroffenen nachhaltig verschlechtert. Besonders weil räumlich bedingte Ausgrenzungsformen zur sowieso schon durch Mangel gekennzeichneten Lebenssituation erschwerend hinzu kommt. (Friedrich 1999: 282)
Die in den letzten Abschnitten aufgezeigte Tendenz der Spaltung der Städte ist nicht nur im traditionellen Sinne zu verstehen, indem sich ein homogenes Zentrum einer entwickelten Stadt resp. darum herum schlecht kommunizierte und unterprivilegierte Satellitenstädte [11] herausbilden, wie dies in traditionellen Stadtentwicklungsmodellen der Fall ist. Eine flexibilisierte räumliche Hierarchie löst vielmehr die fordistische Zonierungslogik auf (Schnur 2003: 23) und eine Fragmentierung tritt an die Stelle konzentrischen Aufbaus der Metropolen, gegenläufige Prozesse verlaufen in der Stadt oft gleichzeitig, die bisher meist monozentrischen Agglomerationen werden zu diffusen polizentrischen Gebilden (vgl. Soja 1990, 1995). Bei der Städtespaltung geht es deshalb vielmehr darum, die sozialen Probleme durch Prozesse der ‚Invisibilisierung‘ (vgl. Reutlinger 2003) aus dem Blickfeld zu schaffen. Wie dies konkret funktioniert, beschreiben Berger/Hildenbrand/Somm anhand des Drogenproblems der Stadt Zürichs. Durch die „Unsichtbarmachung“ verspricht man sich „ein Ende der Konfrontation“ (Berger/Hildenbrand/Somm 2002: 179). Dahinter liegt eine „klassifikatorische Strategie“, die zu neuen Formen sozialer Ungleichheit und zu einem modernisierten Klassenbildungsprozess beiträgt.
Dabei handelt es sich um einen Stigmatisierungs- und Exklusionsprozess gegenüber denjenigen, die dem neuen Leistungs- und Produktionsmodell nicht gerecht werden, wie etwa Migranten, Asylbewerber, Drogenkranke und -händler, Jugendbanden oder Obdachlose. (Schnur 2003: 24)
Die unsichtbaren Mauern sind nicht sichtbar, sondern versteckt. So entstehen erneut ‚Ghettos ohne Mauern‘ (Hess/Mechler 1972). Heute wird die alte räumliche Zentrum-Peripherie-Struktur der Städte zunehmend durch kleinteilig polarisierte Gebiete abgelöst, die nicht physisch-räumlich, sondern versteckt die Bewohner einer Stadt voneinander abgrenzen. Es entsteht ein Raumgefüge, dass mehrfach geteilt ist, wie ein Mosaik oder Leopardenfell (vgl. Berger und Schmalfeld: 317). Durch diese Entwicklungstendenz liegen Armut und Reichtum (kausal und räumlich) eng beieinander. Auch bei der Beschreibung der städtischen Spaltungstendenzen besteht die Gefahr einer Verräumlichung bzw. Verdinglichung durch die Sprache: Durch die Darstellung gibt es mit einem Mal so etwas wie eine ‚erste‘ bzw. ‚dritte‘ Stadt. Es scheint so, als ob man die Gewinner und die Verlierer räumlich festmachen könnte. Dieses Dilemmas bewusst, plädiere ich dafür, die hier beschriebenen idealtypischen Darstellungen der ‚unternehmerischen vs. abgehängten‘ Stadt rein symbolisch und auf keinen Fall physisch-materiell festschreibbar zu verstehen. Es geht nicht um die Territorien in welchen die Menschen mit verschiedenen Voraussetzungen leben und handeln. Es geht viel mehr um die Handlungen der Menschen unter unterschiedlichen, sich ständig in ihren Möglichkeiten distanzierenden Voraussetzungen. Damit können die räumlichen Bezüge von den Konstitutionsleistungen bzw. Handlungen der Menschen her aufgeschlossen werden. Das handelnde Subjekt konstituiert demnach die räumlichen Bezüge vor dem Hintergrund seiner biografischen Bewältigungsaufgaben und der Bedeutungen, welches es der physisch-materiellen, subjektiven und sozialen Welt beimisst.
2. Politik der Kleinräumigkeit am Beispiel der ‚sozialen Stadt‘ - Kritische Anmerkungen aus sozialgeografischer Perspektive
Fasst man die Ausführungen des letzten Kapitels zusammen, so ist die Einsicht der sozialräumlichen Segregation und der damit verbundenen Städtespaltung eine durchgängige Diagnose der aktuellen stadtsoziologischen Diskussion. Ausgangspunkt ist die Einteilung der Menschen und letztlich auch der Stadt in Gewinner und Verlierer, in Abgehängte und Integrierte. Die Stadtforschung geht nun weiter davon aus, dass es räumlich lokalisierbare Territorien gibt, die eine bestimmte physisch-materielle Ausprägung haben und die auch sozial von entsprechenden Merkmalen belegt sind (Prozess der Verräumlichung). Das heißt, dass es nach dieser Logik physische Räume in der Stadt gibt, an denen das Abgehängtsein sich verdinglicht.
Gesellschaftliche Strukturen und deren Veränderungen schlagen sich räumlich nieder, bringen ... sozialräumliche Muster hervor. (...) Es beginnen sich insbesondere in den Quartieren vielfältige und oft schon verfestigte Problemlagen zu konzentrieren, in denen bereits zuvor der Anteil von sozial benachteiligten Bewohnern hoch war und wo nun selektive Wanderungsprozesse einsetzen. (...) Außerdem werden in diesen Gebieten verstärkt Phänomene sozialer Desorganisation, die im öffentlichen Raum sichtbar werden und Gefühle der Verunsicherung und Bedrohung hervorrufen, benannt: Verwahrlosung, gewalttätige Auseinandersetzungen, Drogenkriminalität, Alkoholismus. (Kapphan/Dorsch/Siebert 2002: 8ff.)
Auf die Erkenntnisse der stadtsoziologischen Diskussion bauen nun die aktuellen Städteförderungsprogramme, die sich an die Verlierer der beschriebenen Entwicklungen richten, wie die ‚Soziale Stadt‘, auf: In den Blick geraten abgehängte städtische Territorien. Die Hinwendung weg von bestimmten AdressatInnen bzw. Zielgruppen hin zu bestimmten Territorien liegt seit den 1990er-Jahren im Trend vom wissenschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Diskurs: Das Wohnquartier als sozialräumliche „Einheit“ gewinnt einen immer größer werdenden Stellenwert. „‚Quartier‘ bezeichnet einen sozialen Raum, der kleiner als ein (administrativ abgegrenzter) Stadtteil, aber durchaus vielfältiger sein kann, als ein Wohngebiet, das planungsrechtlich nur dem Wohnzweck dient.“ (Alisch 2002: 60) Der „Quartiersansatz“ geht davon aus, dass im überschaubaren Rahmen der Wohnquartiere oft ungenutzte Ressourcen politischer, sozialer und ökonomischer Teilhabe und neue Chancen integrierter Politikansätze vorhanden sind.
Dabei stehen neben klassischen ‚Sanierungszielen‘ die Bedürfnisse und die ‚Aktivierung‘ der Bewohner, die Nutzung lokal existierender Ressourcen, ein intersektoriales integriertes Handeln sowie die Vernetzung wichtiger Akteure im Vordergrund. (Schnur 2003: 112)
Das Ziel des Artikels lag in der Darstellung der räumlichen Logik des stadtsoziologischen Diskurses. Dieser bildet die Grundlage (explizit oder implizit) des gegenwärtigen Sozialraumdiskurses in der Kinder- und Jugendhilfe. Damit übernimmt die Kinder- und Jugendhilfe auch die Raumlogik der Stadtsoziologie und dies in der Regel ohne sich darüber bewusst zu sein. Damit tendiert die Kinder- und Jugendhilfe dazu, sich als schwache Partnerin der Raumlogik (finanz-)starker Partnerinnen, wie die der Verwaltung oder Stadtplanung, die ihrerseits radikale Modernisierungsprozesse durchleben, zu unterwerfen. Dabei stellt sich heraus, dass die Kinder- und Jugendhilfe keine Definitionsmacht besitzt, sondern sich lediglich auf die ‚Territorien‘ bezieht, die andere definiert haben. Bei der unreflektierten Übernahme der Raumlogik der Stadtsoziologie handelt sie sich massive Schwierigkeiten ein. Die Stadterneuerung definiert Territorien, vergibt Mittel, verändert das Wohnumfeld und die Häuser der benachteiligten Menschen (durch Remodelierung, Betonierung und Sprengung), schickt im Beispiel der ‚sozialen Stadt‘ neue (z.T. konkurrenzierende) Akteure ins Feld (Quartiermanagement) etc. Die Kinder- und Jugendhilfe bezieht sich lediglich auf diese Territorien, ist ohne zusätzliche Mittel. So bezog sich das jugendhilfepolitische Programm E&C in seiner Anfangsphase vollständig auf die im Rahmen der ‚Sozialen Stadt‘ ausgewiesenen ‚Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf‘ und bezeichnete sie als ‚soziale Brennpunkte‘ [12]. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung dieses Programms gelang es jedoch, sowohl für die wissenschaftliche Begleitung, als auch für die politische Steuerung von einem differenzierteren Sozialraumverständnis auszugehen, welches die Menschen als handlungsfähige Subjekte, die ihren Sozialraum konstituieren, in den Vordergrund zu stellen (siehe Projektgruppe „Netzwerke im Stadtteil“ Einleitung). So bezieht sich heute das Programm E&C zwar auf die ausgewählten Gebiete, aber in den Vordergrund treten die Lebensmittelpunkte von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Damit werden auch territoriale Einheiten außerhalb der Fördergebiete miteinbezogen.
Zusammenfassend heisst dies, dass die Kinder- und Jugendhilfe mit der Übernahme der Raumlogik der Stadtsoziologie zwar vorgibt, sich den aktuellen Situationen anzupassen und moderne Konzepte aufzugreifen, dass sie jedoch unter den Bulldozer der Stadtentwicklung zu geraten droht. Zwar wird versucht, über die Regionalisierung sozialer Arbeit von der Zielgruppenförderung wegzukommen und mit der Region zu einer Interventionslogik zu gelangen, die näher an den aktuellen Bedürfnissen der Adressatinnen und Adressaten liegen. Doch droht das Ganze an dem dahinter liegenden Raumverständnis zu scheitern.
In diesem unreflektierten Umgang liegt ein Prozess der Verdinglichung des Sozialraums. In der Krise des Sozialstaates wird ein Prozess der Verdinglichung des Sozialraums dahingehend vollzogen, die Stadtteile zu abgeschlossenen „Containern“ (vgl. Werlen 2005) von sozialen Problemen oder nach den Worten von Richard Sennett, zu „Mülleimern des Sozialen“ (2000) im Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft zu machen. Um nicht die Menschen im Sozialraum ‚einzuschließen‘, gilt es den ‚Sozialraum‘ von den Konstitutionsleistungen bzw. Handlungen des dynamischen Subjektes her aufzuschließen. Dass ein hohes Maß an Differenzierung auch unter den immer diffuser werdenden Bedingungen möglich ist, haben zum Beispiel Berger/Hildenbrand und Somm (2002) in ihrer empirischen Studie über die verschiedenen Lebenslagen und Sozialraumkonstitutionen ganz unterschiedlicher BewohnerInnen eines benachteiligten Stadtteils auf eindrückliche Art und Weise beschrieben.
3. Deutung und Raum - Sozialraumforschungsperspektiven
Insbesondere für junge Menschen könnte die sozialgeografische Forschung in der ‚gespaltenen Stadt‘ an die Überlegungen der ‚Sozialgeografie des Jugendalters‘ (vgl. Reutlinger 2007b) anknüpfen, welche das sozialgeografischen Konzept der ‚Alltäglichen Regionalisierungen‘ von Benno Werlen (vgl. insb. Werlen 1995, 1997 und 2005) für die Jugendlichen anwendet. Darin wird der ‚Sozialraum‘ von den Konstitutionsleistungen bzw. Handlungen des dynamischen Subjektes her aufgeschlossen. Das handelnde Subjekt konstituiert demnach den ‚Sozialraum‘ vor dem Hintergrund seiner biografischen Bewältigungsaufgaben und der Bedeutungen, welche es der physisch-materiellen, subjektive und sozialen Welt beimisst (vgl. Reutlinger 2008).
Ins Zentrum eines Forschungszugangs rücken die (Be)Deutungen, d.h. wie die Menschen (oder Menschengruppen) Orte wahrnehmen. Darüber scheint es möglich zu sein, so die Überlegungen, an der Gestaltung des Sozialräumlichen anzusetzen (Reutlinger/Wigger 2008). Schließlich soll es über die Erschließung der Raumdeutungen gelingen, die Lebensbedingungen bestimmter Gruppen zu verändern. Dies wird beispielsweise in der Grundlegung der sozialräumlichen Methoden der Kinder- und Jugendarbeit deutlich: Das Ziel des „sozialräumlichen Blicks“ liegt darin - so Ulrich Deinet und Richard Krisch - ein „Verständnis dafür zu entwickeln, wie die Lebenswelten Jugendlicher in engem Bezug zu ihrem konkreten Stadtteil, zu ihren Treffpunkten, Orten und Institutionen stehen und welche Sinnzusammenhänge, Freiräume oder auch Barrieren Jugendliche in ihren Gesellungsräumen erkennen. Der Fokus des Erkenntnisinteressens richtet sich daher auf die lebensweltliche Deutungen, Interpretationen und Handlungen von Heranwachsenden (...)“ (Krisch 2002: 87, Hervorgeh. ChR.).
Damit wird die Frage der (individuellen und kollektiven) Raumdeutungen als Prozess der Erschließung von (unterschiedlicher) Bedeutungen und deren Untersuchungsmethoden ins Zentrum des Interessens gerückt. Erst die geeignete Rekonstruktion dieser (Be)Deutungen ermöglicht es, Aneignungschancen unterschiedlicher sozialer Gruppen zu eruieren und Ermöglichungsräume zu eröffnen.
Zu untersuchen wäre, welche Ausprägungen die Bewältigungsformen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien unter den Bedingungen der Verliererseite des digitalen Kapitalismus haben und wie sozialpolitisch darauf reagiert bzw. sozialpädagogische Übergänge geschaffen werden könnten.
Literatur
Alisch, M. (1997): Soziale Stadtentwicklung - Leitlinien einer Politik für benachteiligte Quartiere. Das Beispiel Hamburg. In: W. Hanesch (Hrsg.): Überlebt die soziale Stadt? Opladen, S. 345-361
Alisch, M./Dangschat, J. (1998): Armut und soziale Integration: Strategien sozialer Stadtentwicklung und lokaler Nachhaltigkeit. Opladen
Berger, Ch./Hildenbrand, B./Somm, I. (2002): Die Stadt der Zukunft. Leben im prekären Wohnquartier. Opladen
Berger, O./Schmalfeld, A. (1999): Stadtentwicklung in Hamburg zwischen ‚Unternehmen Hamburg‘ und ‚Sozialer Großstadtstrategie‘. In: Dangschat, J. S. (Hrsg.): Modernisierte Stadt - Gespaltene Gesellschaft. Opladen
Blasius, J. (1993): Gentrification und Lebensstile. Eine empirische Untersuchung. Wiesbaden
Böhnisch, L./Schröer, W. (2001): Pädagogik und Arbeitsgesellschaft. Weinheim/München
Dangschat, J. S. (1991): Gentrification - Indikatoren und Folge globaler ökonomischer Umgestaltung, des Sozialen Wandels, politischer Handlungen und von Verschiebungen auf dem Wohnungsmarkt in innenstadtnahen Wohngebieten. Unveröff. Habilitationsschrift. Hamburg
Dangschat, J. S. (1998): Warum ziehen sich Gegensätze nicht an? Zu einer Mehrebenen-Theorie ethnischer und rassistischer Konflikte um städtischen Raum. In: Heitmeyer, W./Dollase, R./Baackes, O. (Hrsg.): Die Krise der Städte. Frankfurt a.M., S. 21-96
Dangschat, J. S. (Hrsg.) (1999): Modernisierte Stadt - Gespaltene Gesellschaft. Ursachen von Armut und sozialer Ausgrenzung. Opladen
Elsen, S. (1998): Gemeinwesenökonomie - eine Antwort auf Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung? Soziale Arbeit, Gemeinwesenarbeit und Gemeinwesenökonomie im Zeitalter der Globalisierung. Neuwied, Kriftel
Eichel, H. (1991): Wirtschaftsraum Stadt: Stadtqualität als Standortfaktor für die Wirtschaft. In: Ganser, K. u.a. (Hrsg.): Die Zukunft der Städte. Baden-Baden, S. 86-91
Friedrich, M. (1999): Die räumliche Dimension städtischer Armut. In: Dangschat, J. S. (Hrsg.): Modernisierte Stadt – gespaltene Gesellschaft. Ursachen von Armut und sozialer Ausgrenzung, Opladen, S. 263-287
Giddens, A. (1996): Leben in einer posttraditionalen Gesellschaft. In: Beck, U./Giddens, A./Lash, S. (1996): Reflexive Modernisierung. Frankfurt a.M., S. 113-194
Häußermann, H. (1991): Sozialraum Stadt: von der Sprengkraft sozialer Schichtung. In: Ganser, K. u.a. (Hrsg.): Die Zukunft der Städte. Baden-Baden, S. 92-110
Häußermann, H. (1998): Zuwanderung und die Zukunft der Stadt. In: Heitmeyer, W./Dollase, R./Baackes, O. (Hrsg.): Die Krise der Städte. Frankfurt a.M., S. 145-175
Häußermann, H. (2001): Aufwachsen im Ghetto - Folgen sozialräumlicher Differenzierung in den Städten. In: Bruhns, K., Mack, W. (Hrsg.): Aufwachsen und Lernen in der Sozialen Stadt. Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebensräumen. Opladen, S. 37-51
Häußermann, H./Oswald, I. (1996): Stadtentwicklung und Zuwanderung. In: Schäfers, B./Wewer, G. (Hrsg.): Die Stadt in Deutschland. Soziale, politische und kulturelle Lebenswelten. Opladen, S. 85-110
Häußermann, H./Siebel, W. (1993): Festivalisierung der Stadtpolitik. Stadtentwicklung durch große Projekte. Leviathan Sonderheft 13.
Häußermann, H./Siebel, W. (1995): Dienstleistungsgesellschaften. Frankfurt a.M.
Hess, H./Mechler, A. (1972): Ghetto ohne Mauern. Frankfurt a.M.
Heitmeyer, W. (1998): Versagt die „Integrationsmaschine“ Stadt? Zum Problem der ethnisch-kulturellen Segregation und ihrer Konfliktfolgen. In: Heitmeyer, W./ Dollase, R./Baackes, O. (Hrsg.): Die Krise der Städte. Frankfurt a.M., S. 443-468
Hinte, W. (2001): Stadtteilbezogene Soziale Arbeit im ASD - Chancen und Grenzen in struktureller und personeller Hinsicht. In: Hinte, W./Lüttringhaus, M./Oelschlägel, Dieter: Grundlagen und Standards der Gemeinwesenarbeit. Ein Reader für Studium, Lehre und Praxis. Münster; S. 234-261
Jordan, E./Hansbauer, P./Merchel, J./Schone, R. (2001): Sozialraumorientierte Planung, Begründung, Konzepte, Beispiele. In: ISA e.V. Münster
Kapphan, A./Dorsch, P./Siebert, I. (2002): Sozialräumliche Segregation in der Stadt. Literaturbericht. Netzwerke im Stadtteil - Wissenschaftliche Begleitung E&C. Deutsches Jugendinstitut e.V. München und Leipzig
Kessl, F. (2001): Komm rein, dann kannst du rausschau´n! In: Widersprüche H. 82, Bielefeld
Kessl, F./Reutlinger, Ch. (2007): Sozialraum - eine Einführung. Wiesbaden
Kessl, F./Reutlinger, Ch./Maurer, S./Frey, O. (Hrsg.) (2005): Handbuch Sozialraum. Wiesbaden
Krisch, R. (2002): Methoden einer sozialräumlichen Lebensweltanalyse. In: Deinet, Ulrich; Krisch, Richard (Hrsg.): Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit. Methoden und Bausteine zur Konzeptentwicklung und Qualifizierung. Opladen. S. 87-154
Loch, D. (2000): Jugendprotest in französischen Vorstädten. Von der Gewalt zur Integration durch Anerkennungskonflikte? In: Roth, R./Rucht, D. (Hrsg.): Jugendkulturen, Politik und Protest. Vom Widerstand zum Kommerz? Opladen, S. 263-282
Münder, J. (2001): Sozialraumorientierung und das Kinder- und Jugendhilferecht. Sozialpädagogisches Institut im SOS-Kinderdorf e.V. München
Rodenstein, M. (1992): Städtebaukonzepte. Bilder für den baulich-sozialen Wandel der Stadt. In: Häußermann u.a. (Hrsg.): Stadt und Raum. Soziologische Analysen. Pfaffenweiler, S. 31-67
Sassen, S. (1996): Metropolen des Weltmarktes. Die neue Rolle der Global Cities. Frankfurt, New York
Sennett, R. (2000): Interview: Freiheit statt Kapitalismus. In: Die Zeit 15/2000, vgl. http://www.zeit.de/2000/15/200015_beck_sennett.html
Soja, E. W. (1990): Ökonomische Rekonstruierung und Internationalisierung der Region Los Angeles. In: Borst, R./Krätke, S./Mayer, M. (Hrsg.): Das neue Gesicht der Städte. Theoretische Ansätze und empirische Befunde aus der internationalen Debatte. Basen, Boston, Berlin, S. 170-189
Soja, E. W. (1995): Anregung für ein wenig Verwirrung: Ein zeitgenössischer Vergleich von Amsterdam und Los Angeles. In: Hitz, H./Keil, R./Lehrer U. (Hrsg.): Capitales Fatales. Urbanisierung und Politik in den Finanzmetropolen Frankfurt und Zürich. Zürich, S. 160-175
Schmid-Urban, P. (1997): Sozialraum Stadt. Perspektivenwechsel in der Stadtentwicklungs- und Sozialpolitik zur sozialen Kommunalpolitik. In: Blätter der Wohlfahrtspflege - Deutsche Zeitschrift für Sozialarbeit 11+12, S. 233-235
Schnur, O. (2003): Lokales Sozialkapital für die ‚soziale Stadt‘. Politische Geographien sozialer Quartiersentwicklung am Beispiel Berlin-Moabit. Opladen
Reutlinger, Ch. (2003): Jugend, Stadt und Raum. Sozialgeographische Grundlagen einer Sozialpädagogik des Jugendalters. Opladen
Reutlinger, Ch. (2004): Die Notwendigkeit einer neuen Empirie der Aneignung - der Ansatz der Bewältigungskarten. In: Deinet, U./Reutlinger, Ch. (Hrsg.): ‚Aneignung‘ als Bildungskonzept der Sozialpädagogik. Beiträge zur Pädagogik des Jugendalters in Zeiten entgrenzter Lernorte. Wiesbaden, S. 121 - 137
Reutlinger, Ch. (2007): Die Stadt als sozialer Raum und die Raumbezogenheit sozialer Probleme in der Stadt. In: Baum, D. (Hrsg.): Die Stadt in der Sozialen Arbeit. Ein Handbuch für soziale und planende Berufe. Wiesbaden, S. 94-110
Reutlinger, Ch. (2007): Territorialisierungen und Sozialraum. Empirische Grundlagen einer Sozialgeographie des Jugendalters. In: Werlen, B. (Hrsg.): Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen. Band 3: Ausgangspunkte und Befunde empirischer Forschung. Stuttgart, S. 135-164
Reutlinger, Ch. (2008): Raumdeutungen. In: Deinet, U. (Hrsg.): Methodenbuch Sozialraum. Wiesbaden, S. 17-32
Reutlinger, Ch./Wigger, A. (2008): Von der Sozialraumorientierung zur Sozialraumarbeit. Eine Entwicklungsperspektive für die Sozialpädagogik? In: ZfSp 6. Jg., 4 Vj., S. 340-371
Wendt, W.-R. (1989): Gemeinwesenarbeit. Ein Kapitel zu ihrem gegenwärtigen Stand. In: Ebbe, K./Friese, P.: Milieuarbeit. Grundlagen präventiver Sozialarbeit im lokalen Gemeinwesen. Stuttgart, S. 1-34
Rifkin, J. (2000): Access. Das Verschwinden des Eigentums. Frankfurt a.M.
Schnur, Olaf (Hrsg.) (2008): Quartiersforschung. Zwischen Theorie und Praxis. Wiesbaden
Walther, U.-J. (2002): Ambitionen und Ambivalenzen eines Programms. Die soziale Stadt zwischen neuen Herausforderungen und alten Lösungen. In: Walther, U.-J. (Hrsg.): Soziale Stadt - Zwischenbilanzen. Ein Programm auf dem Weg zur Sozialen Stadt?. Opladen, S. 23-43
Werlen, B. (1995): Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen. Band 1: Zur Ontologie von Gesellschaft und Raum. Erdkundliches Wissen. Stuttgart
Werlen, B. (1997): Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen. Band 2: Globalisierung, Region und Regionalisierung. Erdkundliches Wissen. Stuttgart
Werlen, B. (2000): Sozialgeographie. Eine Einführung. Bern, Stuttgart, Wien
Werlen, B. (2005): Raus aus dem Container! Ein sozialgeographischer Blick auf die aktuelle (Sozial-)Raumdiskussion. In: Projekt „Netzwerke im Stadtteil“ (Hrsg.): Grenzen des Sozialraums. Kritik eines Konzepts - Perspektiven für die Soziale Arbeit. Wiesbaden, S. 15-35
Fussnoten
[1] Aufgelegt durch das deutsche Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; siehe www.soziale-stadt.de
[2] Aufgelegt durch das deutsche Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; siehe www.bmfsfj.de sowie www.eundc.de
[3] Die Tendenz des „digitalen Kapitalismus“ führt nicht mehr zu einem Diskurs „zur sozialen Emanzipation und Autonomie tendenziell aller Menschen einer Gesellschaft, sondern - nach dem postmodernen Prinzip der segmentierten Arbeitsteilung - zur sozial erweiterten Freisetzung eines Teils und sozial regressiven Freisetzung des anderen Teils (der ‚nichtproduktiven‘ Gruppen) der Bevölkerung“ (Böhnisch/Schröer 2001: 228).
[4] In diesem Zusammenhang wird auch von „dual cities“ oder „two cities“ gesprochen. (vgl. dazu Alisch/Dangschat 1998: 87).
[5] Dabei geht es z.B. bei einem Drogenproblem nicht mehr darum, dass das Sozialamt einer Stadt Sozialarbeiter anstellt und ein Interventionsplan erstellt wird, sondern mit der Lösung wird eine Privatfirma beauftragt. Dies spart Kosten, welche für die soziale Sicherheit der Beamten ausgegeben werden müsste. Meistens wird der Auftrag der kostengünstigsten Firma übertragen, was wiederum Konsequenzen auf die Arbeitsbedingungen der Angestellten dieser Firmen hat.
[6] „Weich heißt, daß diese nicht so knallhart von den Betrieben kalkuliert werden wie z.B. Lohnkosten, Transportkosten, Bodenpreise usw. Sie können nicht mit einem Investitionsplan hergestellt werden und wirken eher aufs Gemüt. Die unverbrauchte Landschaft gehört dazu, das Wetter und das schöne Ambiente.“ (Häußermann/Siebel 1995: 124)
[7] Es wird zwischen dem Begriff der ‚Gentrification‘ (als Zustand) und ‚Gentrifizierung‘ (als Prozess) unterschieden. Dabei wird der Begriff ‚Gentrification‘ verwendet „zur Beschreibung eines schnellen Ansteigens des Anteils an Bewohnern der (oberen) Mittelschicht in ehemaligen Arbeiterwohnquartieren bzw. in zuletzt von Arbeitern bewohnten Gebieten. Dieser Vorgang geht einher mit einer Modernisierung des Wohnungsbestandes sowie der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen“ (Blasius 1993: 14). „Gentrifizierung ist die Verdrängung der ehemaligen Bewohner durch jüngere, besser ausgebildete und in der Regel mit höherem Einkommen versehene Haushalte in innenstadtnahen Wohngebieten. Mit Verdrängungen sind Auszüge aufgrund von Mietsteigerungen oder Umwandlungen ehemaliger Mietwohnungen in Eigentumswohnungen gemeint. Damit einher geht in einem Wechselwirkungsprozeß eine Veränderung des Wohnungsbestandes in Richtung überdurchschnittlicher Modernisierung, Mietpreissteigerung und der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen resp. eine Veränderung der Infrastruktur, die zunehmend den Bedürfnissen der neu Hinzuziehenden entspricht“ (Dangschat 1991: 32).
[8] Die neuere Armutsforschung geht von dem direkten Zusammenhang der Steigerung der Armut durch den verbreiteten Wohlstand aus (vgl. u.a. Alisch/Dangschat 1993, 1998; Dangschat 1999).
[9] Berger/Schalfeld beschreiben die Strategien, die zur Beibehaltung des sozialen Friedens dienen. In diesem Zusammenhang wird von der „sozialen Großstadtstrategie“ gesprochen (Berger/Schalfeld 1999: 329ff.).
[10] Meistens wird unter Segregation die ungleiche Verteilung der Wohnbevölkerung in einer Stadt verstanden; man spricht dann auch von der residentiellen Segregation. Für die vorliegende Arbeit soll die Segregation weiter gefasst werden: Unter Segregation soll allgemein die ungleiche Verteilung von Einheiten (z.B. sozialen Gruppen, unterschiedlichen Handlungsformen) im Raum verstanden werden.
[11] Diese Tendenz ist aber weiterhin in modernen Städten zu beobachten. Dies zeigen auf eindrücklichste Weise die von der französischen Rechtsregierung unter Le Pen geführten Stadtpolitiken im Süden von Frankreich, in denen sämtliche Kommunikationsmöglichkeiten von Bewohnern von Satellitenstädten, meistens marokkanische resp. algerische Einwanderer, abgeschnitten werden (vgl. Loch 2000). Sie bleiben in diesen Satellitenstädten isoliert und haben gar nicht die Möglichkeit, ins Zentrum zu gelangen. „Die räumliche Ausgrenzung verhindert häufig (...) die Teilhabe an und die Erreichbarkeit von Ausbildungseinrichtungen und Arbeitsplätzen, angemessenem Wohnraum und gut ausgestatteten Wohnquartieren sowie öffentlicher und privater Infrastruktur.“ (Dangschat 1999: 14)
[12] ‚Soziale Brennpunkte‘ sind Wohngebiete, „in denen Faktoren, die die Lebensbedingungen ihrer Bewohner und insbesondere die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen negativ bestimmen, gehäuft auftreten“ (Deutscher Städtetag 1979: 12) - nach Häußermann „ein Sprachgebrauch, den man inzwischen vermeidet, weil er ein Bild hervorruft, es handle sich um punktuelle Probleme, die man rasch mit der Feuerwehr löschen könne“ (Häußermann 2001: 38).
Reutlinger, Christian: „Gespaltene Stadt und die Gefahr der Verdinglichung des Sozialraums. - eine sozialgeografische Betrachtung“, in: Projekt „Netzwerke im Stadtteil“ (Hrsg.) (2005) „Grenzen des Sozialraums. Kritik eines Konzepts - Perspektiven für die Soziale Arbeit“, Wiesbaden, VS-Verlag, S.:87-108
Mit freundlicher Genehmigung des VS-Verlags.
Zitiervorschlag
Reutlinger, Christian (2009): Vom Sozialraum als Ding zu den subjektiven Raumdeutungen. In: sozialraum.de (1) Ausgabe 1/2009. URL: https://www.sozialraum.de/reutlinger-vom-sozialraum-als-ding.php, Datum des Zugriffs: 21.01.2025

